Obwohl ich über die letzten Jahre viel über mich und meine Gefühlswelt gelernt habe, obwohl ich es mittlerweile schaffe, nicht mehr hinter dem Lenkrad zu schimpfen oder laut zu fluchen, wenn mir mal wieder etwas runterfällt, werde ich doch immer noch oft von großen, negativen Gefühlen übermannt. Sind es nur kurze Anwandlungen von Wut oder Trauer, schaffe ich es, kurz innezuhalten und mich neben dieses Gefühl zu stellen. Darauf bin ich mächtig Stolz. Aber manchmal, wenn mal wieder alles zusammen kommt – das schlechte Wetter, ein blöder Streit, und dann noch ein kurzer, verheerender Blick auf das aktuelle Weltgeschehen – dann schaffe ich es nicht. Dann stapelt sich ein Gefühl auf dem nächsten, und noch bevor ich das Erste verstanden habe, prasselt das Nächste auf mich ein. Und dann fühle ich mich schrecklich klein, wie jetzt. Ich sitze daheim in meiner heilen Welt, meinem eigenen kleinen Biotop Heimat, während überall da draußen die Welt unterzugehen scheint. An solchen Tagen hätte ich gerne eine Lösung für all das. Ein „jetzt weiß ich endlich, wie ich die Welt verbessern kann“. Ich hätte gerne ein Gefühl von Bedeutung in dieser Welt – ich würde an solchen Tagen gerne Abends in den Spiegel sehen und sagen können: „Heute hast du die Welt gerettet“. Aber das schaffe ich nicht. Das schafft niemand. Und dann kommt wieder dieser toxische Gedanke, der mich lähmt: „Ich bin doch nur einer von sieben Milliarden, was kann ich schon ausrichten?“
Und dann klingelt es an der Tür. Ich klettere aus meinem Heilewelt-Bett und öffne meinem Nachbarn aus dem 2. Stock die Tür. „Servus Angelina!“, ruft er in den Flur, mit seiner rechten Hand hält er sich am Treppengeländer fest, in der Linken die typische, vollbepackte V-Markt Tüte. Er nennt mich so, seitdem wir uns kennen, ich habe es irgendwie verpasst ihn zu verbessern, der Zug ist abgefahren. Also bin ich seitdem die Angelina. „Brauchst du mich?“, frage ich. „Ja, das wär toll. Ich habe wieder einen Karton Milch im Kofferraum“, und wie jedes mal, auch noch nach sechs Jahren, erklärt er mir, dass ihm der Karton leider zu schwer ist, weil er nicht mehr so gut laufen kann, und er sich auf dem Weg nach oben festhalten muss.
Seine Wohnung ist klein, ziemlich zugestellt und verraucht. Eine Woche, nachdem ich nach Hawaii flog, starb seine Frau. Ich erfuhr davon erst nach meiner Rückkehr, und es tat mir im Herzen weh, dass ich zu dieser zeit nicht da sein konnte. Vor einer Woche starb auch noch sein Kater, nach 16 Jahren. Er war genau so alt wie Sherry. Seitdem wohnt er allein hier oben. Ich stelle den Milchkarton wie immer auf seinem Bett ab und gehe zu ihm in die Küche. Er lässt mich nur selten gehen, ohne mir ein kleines Dankeschön mitzugeben – meistens ein paar Dosen (ganz akzeptables) tschechisches Bier. „Schau mal Angie, ich hab auch noch einiges für dich. Brauchst du Futternäpfe? Ich habe bestimmt noch 5 Säcke Katzenstreu, meine Schwester kauft mir das immer auf Vorrat, weil ich es ja nicht tragen kann.“
Eine Stunde später bin ich immer noch dort oben. Wir sitzen im Wohnzimmer, rauchen zu viel und irgendwie hab’ ich auch einen Schnaps getrunken. Er erzählt mir von wilden Geschichten aus seinen Zwanzigern, als er die ganze Welt bereiste und davon, dass er wieder eine neue Freundin hat, aber nicht so weiß, ob er mit ihr hier zusammenwohnen will. Das ist ja immerhin seine und Rosis Wohnung gewesen.
Ein bisschen später laufe ich leicht angeschwippst wieder runter in mein wohliges Heimat-Biotop und lese die Worte, die ich vorhin über meine Verzweiflung geschrieben hatte. Und bemerkte, wie anders, wie viel besser ich mich jetzt fühle. Ich fühle mich irgendwie nicht mehr so trostlos, irgendwie nicht mehr so klein. Ein kleines bisschen größer. Als hätte die Welt mit einem mal wieder etwas mehr Farbe bekommen. Und wie immer, wenn ich einen unverhofften Weg aus meiner Misere gefunden habe, möchte ich herausfinden, woran es liegt – damit ich es auf meine “was tun, wenns dir scheisse geht”-Liste schreiben kann. Ich habe doch nichts anderes getan, als meinem Nachbarn seine Einkäufe hochzutragen und ein bisschen mit ihm zu plauschen. Das, was ich getan habe, war so klein, und fühlt sich doch irgendwie groß an. Ich finde eine ganz simple, logische Erklärung:
Helfen macht Glücklich.
As simple as that. Wenn ich anderen Menschen helfe, fühle ich mich wertvoll – mein Selbstwertgefühl steigt. Mein Körper schüttet Glückshormone aus, das hat die Natur sich wohl einfach so überlegt. Da trage ich meinem Nachbarn nur ein paar Tüten hoch und werde mit einer kleinen Dosis Dopamin belohnt. Nach einem „Dankeschön“ gibt’s sogar noch mehr an positiven Gefühlen: Ein aufrichtiges und ehrliches „Danke“ hat mir schon all zu oft den Tag gerettet. Ihr kennt das bestimmt.
Und dann ist da natürlich noch Ubuntu. Ich mag das Wort so gern. Ubuntu ist das Verbundensein, das Gefühl von Miteinander. Menschlichkeit. Ich bin, weil Wir sind – oder: “Ein Mensch wird erst durch andere Menschen zum Menschen”, wie Desmond Tutu es im “Buch der Freude” schrieb, welches ich vor einiger Zeit las. Ich fühle mich nicht mehr klein und abgegrenzt, sondern als Teil dieser Menschheit. Ein großartiges Gefühl – hallo Glückshormon.
Vielleicht gibt es so etwas wie uneigennütziges Helfen gar nicht – und vielleicht ist das auch gut so. Es ist schon ein kleines Wunder der Natur, dass das anscheinend selbstloseste der Welt das Selbst am meisten Stärkt.
Drehen wir das Rad doch mal ein bisschen weiter. Wieder zu dem Moment, an dem ich in den Spiegel sehe und mir wünschte, ich könnte von mir selbst behaupten, ich hätte heute die Welt verbessert. Wenn Helfen eine Arte Perpetuum Mobile ist, wenn ich mich selbst mit Freude nähre, indem ich anderen Freude bereite, wo führt all das hin?
Ich fühle mich verbundener. Den Menschen näher, verwurzelt in der Welt. Wenn ich helfe, schaffe ich einen Wert – deshalb schreibe ich diesen Blog hier. Weil ich eure Dankbarkeit spüre, weil ich sie lese, weil sie mich stärkt, jeden Tag. Ich sage immer, dass ich gut für mich selbst sorgen muss, und das erreiche ich am besten, in dem ich auch für andere „sorge“. Auf egal welche Art und Weise, mit einem Post wie diesem – oder mit einer Kiste Milch.
Helfen ist wie Antidepressiva. Helfen, egal wie klein die Hilfe auch sein mag, bewirkt etwas in dieser Welt. Weil du dadurch für dich selbst sorgst. Weil du dadurch positiver wirst, weil du Ubuntu wieder spürst. Und wenn ich dann mit mir selbst im Reinen bin, wenn ich mich verwurzelt und wertvoll fühle – wen soll ich dann noch hassen? Wen soll ich nicht mit offenen Armen empfangen?
Wie sähe unsere Welt aus, wenn jeder ab und zu den Menschen in seiner Umgebung etwas Gutes tut? Vielleicht wären wir alle ein Stück Glücklicher. Ein Stück gesünder, fühlten uns ein Stück verbundener. Ein Stück weniger ängstlich mit größerer Akzeptanz für Fremde und jenen, die anders sind als wir.
Sorg gut für dich, und du sorgst für die ganze Welt. Wenn du die Welt verbessern willst, dann klappt es nicht mit Wut, Neid oder Hass im Herzen. Es klappt einzig und allein mit Liebe – die du nur fühlen kannst, hast du sie auch für dich selbst. Lass dir dabei von anderen helfen – indem du ihnen hilfst.


Diesen Button hier gibt es, damit ich weiterhin meine Zeit in Posts wie diese investieren kann.
Wenn dir dieser Beitrag gut gefallen hat, lass’ mir gerne ein paar Euro da. Mehr dazu erfährst du hier!
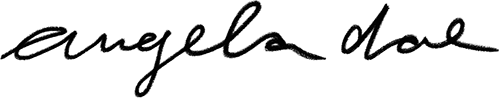








So wunderbar geschrieben und einfach sagte Worte. Danke dafür (wie immer).
Wunderschöner Post liebe Angela.
Auch ich bin heute mit doofer Laune aufgewacht, weil ich das Wochende doch mehr gesündigt habe als ich sollte und war wütend auf mich selber.
Ich habe versucht aus dieser Laune rausgekommen, diesen Post gelesen und gerade meinem Arbeitskollegen geholfen und ein herzliches, aufrichtiges Danke empfangen. Mir geht es viel besser. Vielen Dank für deinen Tipp. Du hast Recht, helfen hilft ;) Du hast mir den Tag dadurch gerettet. Danke!
Liebe Vini,
gesündigt? Ich hoffe es geht hier nicht um essen! Beim Essen gibt es nämlich keine Sünden. Aber ich freue mich natürlich, dass ich dir helfen konnte indem du geholfen hast und dir selbst geholfen hast und jetzt fühl ich mich auch besser, weil ich dir geholfen habe. Haha, herrlich :D
So schöne und wahre Gedanken liebe Angela. Danke dafür (und das ist auch eines dieser ganz ganz aufrichtigen Dankeschöns =))
Ich habe genau so einen nachbarn auch!! und jedes mal wenn er klingelt und sich so sehr und lieb bedankt freue ich mich darüber. noch nie habe ich mich von ihm genervt gefühlt. helfen ist einfach schon!
<3
Du kannst dich so toll ausdrücken. Immer wenn ich deine Texte lese gehe ich danach mit so einem beflügelten Gefühl raus :)
Liebst,
Chris
Liebe Angela, vielen Dank für diese tollen Worte :)
Schön!
Ein schöner Text! Du hast einen Weg für dich gefunden – deine Worte berühren und regen zum Nachdenken an und du hilfst deinem Nachbar! Es gibt so viele u terschiedliche Wege etwas zu bewegen…. Manche engagieren sich in der Freiwilligenarbeit, andere versuchen von Unternehmen aus die Welt zu verbessern oder aus der Politik heraus. Da muss jeder für sich wissen, welchen Weg man gehen will! Und dass du deinen zeigst, ist schön und inspirierend :)
Aber eine Anmerkung habe ich – Diese Einstellung wie “das schlimme aktuelle Weltgeschehen”, “die Welt heutzutage”, “Die Welt wird immer verrückter” und ähnliche Aussagen – da habe ich das Bedürfnis, einmal laut STOP zu schreien. Ich verstehe, was du in deinem Text meinst. Aber generell: Einfach mal 80 Jahre zurückdenken. DA war die Welt verrückt! Heute kriegt man einfach mehr durch die Medien mit, aber nationale und internationale Konflikte nehmen nicht zu. Man darf nicht vergessen, dass es alles nur subjektive Wahrnehnung ist. In der Vergangenheit gab es immer wieder Krisen und Terrorismus (Afghanistan, Ruanda, die RAF). Man darf nur nicht den Kopf in den Sand stecken und sich denken, dass die Welt da draußen verrückt spielt. Das tat sie, tut sie und wird sie immer tun.
Und wir werden immer Möglichkeiten haben, sie und die Menschen um uns in unserem Rahmen zu beeinflussen! :)
Danke!