Ich beobachte das kleine Mädchen. Ich weiß von ihrer Mutter, dass sie erst vor ein paar Wochen mit dem Laufen begonnen hat, und so stackst sie unsicher aber voller Erkundungsdrang zwischen den Hochzeitsgästen umher. In der Hand trägt sie einen kleinen Eimer mit Rosenblättern. Kurz bleibt sie stehen, blickt in den Eimer und beginnt, ihn energisch zu schütteln – bis sich all die Rosenblätter um sie herum auf den Kies verteilen. Ihr Vater lacht, streicht ihr über den Kopf und sagt: “Na, nun musst du sie aber auch alle wieder aufsammeln.” Emma guckt verdutzt zu Boden, in den leeren Eimer, wieder auf den Boden. So viele Blätter.
Ich beschließe ihr zu helfen. Wir kennen uns nicht besonders gut, also setze ich mich erstmal zu ihr auf den Kies, bevor ich sie anspreche. Einen kurzen Moment fühlt es sich seltsam an, immerhin befinde ich mich jetzt auf Kniehöhe aller anderen Gäste – aber ich bin nun auf Emmas Augenhöhe.
Und die findet das prima. “Ich helfe dir”, sage ich, hebe ein einzelnes Blatt auf und strecke es ihr hin. Sie greift danach, blickt in den leeren Eimer, und wirft das erste Blatt hinein. Und sieht mich wieder erwartungsvoll an. Ich nehme ein weiteres, einzelnes Blatt und halte es ihr erneut hin. Wieder nimmt sie es und schmeißt es in den Eimer zurück. Und lacht. Ich greife nach dem Dritten.
“Du hast ja eine Engelsgeduld”, sagt ein auf uns herabblickender Beobachter. Wir sind jetzt bestimmt beim fünfzigsten Blatt angekommen, wie viele Minuten vergangen sind, weiß ich nicht. Ich nehme einfach ein Blatt nach dem anderen und erfreue mich daran, wie Emma sich freut. Wieder und wieder und wieder, bis der Eimer voll ist.
An diesem Tag fragte ich mich, warum mich diese seltsame, monotone Tätigkeit nicht nervte, bin ich doch sonst so furchtbar ungeduldig. Und wieso ich auf einmal wieder “so gut mit Kindern” konnte. Ich hatte mich bereits damit abgefunden, dass ich irgendwie keinen richtigen Draht mehr zu Kindern fand – sie schüchterten mich ein mit ihrer Ehrlichkeit. Einem Kind nah sein, mit ihm spielen und Blödsinn machen empfand ich zwar schon immer schön – aber ich wollte ihnen nie zu nahe treten (ich erinnere mich hier an meine Kindheit, und wie ich immer gehasst habe, von fremden umarmt oder gar abgeknutscht zu werden). Vor meiner Teenagerzeit ging ich mit einer wunderbaren Leichtigkeit an Kinder heran, die ich, je älter ich wurde, irgendwie verlor. Ich wurde unsicher – und Kinder spüren das.
In letzter Zeit aber erwischte mich wieder öfter dabei, wie ich Kindern entweder ewig lang zusehen konnte bei ihren Spielereien, oder wie ich mich in ihrer… Schönheit verlor. Das mag seltsam klingen, aber wie oft ich ein Kind in letzter Zeit als “außergewöhnlich schön” beschrieb, fand ich irgendwann selbst nicht mehr ernst zu nehmen.
Ich war mir immer schon unsicher, ob ich selber mal Kinder möchte. Ob ich Kinder in diese Welt setzen möchte, ob ich eine gute Mutter sein könnte. Ich erklärte mein “seltsames Verhalten” und die neuen Gefühle, die der Anblick eines Kindes in mir auslöste, ganz einfach damit, das ich jetzt nunmal 27 bin. So wie ich irgendwann meine Periode bekommen habe kommen jetzt altersbedingt irgendwelche Muttergefühle in mir auf. Irgendwie so. Klingt logisch.
Vielleicht ist das ja wirklich so, eben biologisch bedingt. Vor ein paar Wochen aber fand ich eine weitere Erklärung:
Ich befand mich auf einem Firmen-Sommerfest auf dem Land, es regnete und die Feier fand gemütlich in einem großen Zelt statt. Natürlich wuselten auch ein paar Kinder umher. Ein Mädchen fiel mir besonders auf (natürlich eines der schönsten Kinder, dass ich jeeeemals gesehen hatte). Sie rannte aufgeregt zu ihrer Mutter und rief: “Mama, wo ist meine Matschhose? Ich brauche meine Matschhose!” Ich musste lachen, weil sie so überzeugt klang, als sei das Tragen dieser einen, wasserdichten Hose, gerade das Wichtigste auf der Welt. Als wäre sie wütend darüber, dass niemand sonst das Dilemma über die nicht vorhandenen Matschhose versteht.
Ein bisschen später, als ich das Zelt kurz verließ, um auf Toilette zu gehen, fand ich das Mädchen wieder – sie hatte ihre Matschhose bekommen. Fest eingepackt mit Jacke, Kapuze, Matschhose und Gummistiefeln kniete sie auf der nassen Wiese, die nackten, schmutzigen Hände vergraben in der Erde. Sie hatte ein ziemlich beachtliches stück Wiese aufgebuddelt. Diese Szene fesselte mich so, wie es kaum ein Film in letzter Zeit getan hatte. Ich wünschte mir in diesem Moment, ich hätte auch eine Matschhose. Ich wünschte mir, ich könnte mich kurz mal aus der Ewachsenenwelt ausklinken, mich zu ihr runterknien, meine Hände im Matsch vergraben und genau mit dieser einfachen Tätigkeit so glücklich sein, wie das kleine Mädchen.
Aber ich bin erwachsen. Ich bin kein Kind mehr, ich bin siebenundzwanzig und ich darf mir a) nicht meine Hose schmutzig machen, b) ist Matsch doch super unhygienisch, c) werden dann meine Haare nass und sehen scheisse aus und d) wäre ich einfach für alle Anwesenden hier verrückt. Ich wünschte mir, all diese Gedanken würden einfach von mir abfallen. Ich wünscht mir, ich könnte alle Gefühle, die mich davon abhielten, abschütteln.
Ich wollte so sehr dieses Mädchen sein. Dieses Mädchen, das nur den Moment kennt, den es gerade erlebt. Kein morgen. Kein gestern. Keine von der Gesellschaft eingepflanzten Gedanken, ob das jetzt “angebracht” ist, was sie gerade tut, ob es “schmutzig” oder gar “ekelhaft” erscheint.
In diesem Moment begriff ich, was mich an Kindern (wieder) so faszinierte. Nein, es ging bestimmt nicht um den Matsch. Die Szene erinnerte mich an das Zitat eines meiner Lieblingsautoren Patrick Rothfuss:
Die Welt um mich herum wird schneller. Immer schneller. Ich werde älter und alles, worum es geht, alles, wovon jeder immer spricht, ist das, was mal sein wird. Womit wirst du dein Geld verdienen? Wann zahlst du endlich in die Rentenkasse ein? Was willst du noch erreichen, wer willst du sein?
Und ich? Ich werde langsamer. Anstatt in dieser Leistungsgesellschaft mitzumachen, sitze ich still. Anstatt mich um schneller, höher und heiter zu sorgen setzte ich mich hin und höre auf meinen Bauch.
Nein, eigentlich ist das nicht ganz richtig. Nicht immer.
Ich mache mir sehr wohl Gedanken darüber, wer ich in den Augen der anderen bin und wohin ich gehen möchte. Jeden Tag mache ich mir sorgen um die Zukunft, und viel zu oft erschlagen mich diese Sorgen. Sie erschlagen mich bis ich wieder an dem Punkt bin, an dem ich Bewegungsunfähig bin und nichts tue.
Aber eines weiß ich ganz sicher: Der Ausweg aus meinen Ängsten, aus meiner Misere, ist nicht der Blick in eine hoffentlich glorreiche Zukunft, in der “alles besser sein wird”. Wir verschwende Tage, Wochen, Monate damit, zu laufen, einer Zukunft entgegen, in der “alles besser sein wird als jetzt” – anstatt mich auf das einzige zu konzentrieren, was ich wirklich leben kann: Das Jetzt. Genau hier, dieser Augenblick. Den kann ich leben. Die Zukunft kann ich nicht leben, die Vergangenheit kann ich nicht leben. Ich will nicht mein Leben lang den gegenwärtigen Augenblick hassen und immer nur hoffen, dass irgendwann alles besser wird.
Ich will Augenblicke leben können, immer. Und wenn das für den Rest der Welt bedeutet, ich sei ein Kind, dann heißt das zumindest, dass ich glücklich bin. Kinder sind das beste Beispiel dafür, wie wunderbar die kleinsten Nichtigkeiten im Leben sein können, betrachtet man sie ohne das, was einmal war und ohne das, was einmal sein wird.
Natürlich müssen wir alle Geld verdienen. So funktioniert diese Welt nunmal. Aber ich werde einen Teufel tun und mein Leben davon bestimmten lassen, was andere von mir erwarten und wie mich andere sehen. Ich will sein. Und das kann ich nur, wenn ich endlich herausfinde, was ich eigentlich wirklich will. Oder ob das, was ich will, was ich “erreichen” will, eigentlich nur eine trügerische Vorstellung dessen ist, was die Gesellschaft von mir erwartet.

Dieser Blog hier soll so weit wie möglich unabhängig von Marken,
Sponsored Posts und Affiliate-Links sein.
Deshalb gibt es diesen Button hier –
damit ich weiterhin meine Zeit in Posts wie diese investieren kann.
Mehr dazu erfährst du hier!
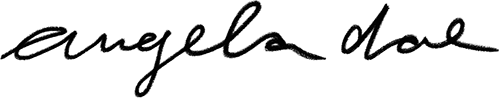










Liebe Angela,
danke für diesen tollen Text. Danke auch für all die anderen tollen Texte, aber für diesen ganz besonders, denn er spricht mir so aus dem Herzen. Bewahr dir dein inneres Kind, bitte, und ich hoffe wirklich sehr, dass du einen (beruflichen) Weg findest, der dich glücklich macht und sich mit deiner Lebensphilosophie vereinen lässt.
Ich kann mich an ein Lied erinnern, dass ich früher zusammen mit meinen Eltern auf CD gehört habe und das mich heute noch sehr bewegt, wahrscheinlich sogar mehr als früher. Vielleicht hast du Zeit, dir den Text durchzulesen. Ich finde ihn einfach so so wahr: http://www.reinhard-mey.de/start/texte/alben/du-bist-ein-riese-max
Alles Liebe,
Maria
Oh, das ist wirklich ein wunderwunderbarer Text. Danke dafür. :))
Ein wundervoller Text liebe Angela!
Und ich habe mit sehr gefreut einen Beitrag von dir in meiner Timeline zu entdecken.
Liebts, Alexandra
Du schreibst so wunderwunderschön.
Ich lese deinen Blog jetzt schon seit ein paar Jahren (seitdem du mal beim Schlachthofflohmarkt was bei mir gekauft hast und eine Freundin zu mir meinte, “das ist doch so eine Bloggerin, oder?”) und finde deine Entwicklung so toll. Und ich hoffe, du hast keine Hemmungen, hier wirklich ehrlich das zu schreiben, was du schreiben willst – egal, wie gut das bei einigen ankommen mag. Nur pretty pictures gibt es anderswo genug.
Ich wünschte, wir könnten noch häufiger so tolle Texte von dir lesen. Denn immer finde ich auch ein Stück von mir selbst darin. Oft genug verliere ich mich zum Beispiel selbst in dieser leistungsgetriebenen Welt und habe fast so etwas wie Schuldgefühle, auf jeden Fall aber ziemliche Selbstzweifel, wenn ich mich in dieser nicht wohl fühle – und frage mich, was denn nicht mit mir stimmt. Warum ich diese acht Stunden Arbeit am Tag nicht unter “immerhin wird es ganz gut bezahlt” oder “es gibt noch viel schlimmere Jobs” abhaken kann. Und stelle mich selbst in Frage, wenn ich bemerke, dass ich tausendmal glücklicher war, als ich noch “stupide” und fast monoton vor ein paar Jahren neben dem Studium in einem Café gearbeitet habe. Warum bin ich denn in diesem viel anspruchsvolleren Job, der viel besser zu meinen Qualifikationen passt, nicht auch viel glücklicher? Wie oft ich mich schon in das Café zurückgewünscht habe.
Ich hoffe, wie du, dass ich auch noch das finde, was ich wirklich will und womit ich wirklich glücklich sein kann.
Liebe Sina,
ohja, ich erinnere mich an dich! Schmuck habe ich gekauft, oder? Oder zumindest angesehen oder so. :)
Ich weiß, dass ich mich mit dem, was ich tue, sehr gegen die Gesellschaft sträube – aber ich bin auch der Meinung, dass man Freude an etwas finden kann, was einem die Freude eigentlich schwer macht. Solange du nicht totunglücklich bist mit deinem Job und dem was du tust kann dich, glaube ich, sehr wohl glücklich machen. Letztendlich kommt Glück ja nur aus einem selbst heraus. Und hey, wünsch dich nicht zurück! Man kann doch nur den Moment leben, der gerade ist! ;)
Frag dich ganz genau, WAS dich an deinem Job stört. Vielleicht kannst du es dir selbst schöner machen.. und sei es nur mit Musik, einem schöneren Schreibtisch (sitzt du an einem? :D), besserem essen, geh öfter zwischendurch mal allein an die Luft… so Kleinkram kann Wunder wirken. Ich wünsche dir alles alles gute, und falls wir uns mal wieder sehen sag bitte hallo! :)
Großartiger Text, der einen wundervollen Bogen vom Kind-sein zum erwachsenen Alltag schlägt!
Was für ein wundervoller Gedanke zim Sonntag. Mein Freund und ich besprechen beinahe jeden Sonntag unser Weltbild am Frühstückstisch, das ist schon wie ein Ritual, und heute klang das bei uns ganz ähnlich wie bei dir :) Schön, dass es noch andere Menschen gibt, die gegen die Regeln denken. (Und Patrick Rothfuss genau so gern mögen wie wir.) Und natürlich, wie immer, toll geschrieben.
Liebste Grüße
Und weißt du was? Genau diese Momente, das Da-Sein, das Wahrnehmen, das du bei den Kindern beobachtest, diese kommen alle zurück. Und zwar dann, wenn ein eigenes Kind um dich rumwuselt. Jeder Tag zählt, ist neu, unbekannt, großartig. So viele erste, absolut bezaubernde Male, die Freude über Steine, Käfer, Fusseln…
Und man kann so herrlichen Blödsinn machen ;-)
Oh ja, das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Ich sehe auch schon selbst wie sich die Leute ändern, sobald sie Kinder haben. :)
Ach Liebes <3
dieses erwachsensein ist doch eh vollkommen überbewertet und ich denke rentenkassen sind es auch. lass dich von diesem unsinn, der in bayern einen sicher viel mehr erschlägt, als in berlin, nicht wahnsinnig machen und lieber das Leben spielerisch erleben und froh sein, dass man kein Kind mehr ist, sondern ein freier(!) erwachsener. Du kannst dir deine spielzeuge holen wann immer du willst und musst nicht erst um erlaubnis fragen ob du süßigkeiten essen willst. hat alles eben vor und nachteile :D
Also Kopf hoch und ich glaube du wärst eine fantastische mutti <3
Haha ja, das stimmt. Ich glaube auch einfach, dass Erwachsensein heute etwas ganz anderes bedeutet als früher. Man dachte immer: “Wenn ich erwachsen bin, bin ich wie meine Eltern”. Aber wir sind eine komplett andere Generation – unser Erwachsen ist was ganz, ganz anderes. :)
<3
Angela,
ich habe deine Texte vermisst!
Du fasst genau das in Worte, was mir seit einiger Zeit im Kopf herumspukt. Ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich immer nur die Zukunft plane anstatt einfach mal im Jetzt zu leben, mich über Kleinigkeiten zu freuen.
Und dazu glaube ich, dass du eine großartige Mama wärst. So einfühlsam, liebevoll und eben auf die kleinen Dinge schauend.
Du sprichst mir absolut aus der Seele!
Liebe Angela,
ich wollte dir neulich schon sagen, wie schön ich deine Art und Weise finde mit den Krisen umzugehen, mit denen wir uns alle konfrontiert fühlen. Zukunft, Beruf, Geld, Moral. Dass du bereit bist auf Werbung und Kooperationen mit Firmen zu verzichten, die du moralisch nicht mehr vertreten kannst, um dir selbst treu zu bleiben, finde ich grandios und inspirierend. Das bedeutet zwar, dass dich dieser Blog nicht mehr trägt, aber dafür trägst du ihn weiter. Und das ist doch sowieso viel persönlicher. Ich bin 26 und habe auch noch nichts in meine Rentenkasse eingezahlt. Tatsächlich habe ich gerade erst mit meinem Bachelorstudium begonnen. Aber ich habe entschieden, dass diese Tatsache wertfrei ist. Wer bin ich denn, mich durch willkürliche Karriereideale unserer Gesellschaft einschränken zu lassen, die auf mein Leben einfach nicht passen? Wieso vergleiche ich mich andauernd mit einer Freundin, die schon seit ihrem 18. Lebensjahr arbeitet und mittlerweile richtig Kohle macht? Wieso habe ich so furchtbar Angst, im jetzt Entscheidungen zu treffen, die meine Zukunft beeinflussen? Im Endeffekt gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft. Die Zeit ist eine menschliche Erfindung und ein menschliches Empfinden. Ich hoffe, dass ich es schaffe mich von diesem haltlosen Gegrüble irgendwie freizumachen. Und ich hoffe, du schaffst das auch. Weniger dann, mehr jetzt :)
“Die Zeit ist eine menschliche Erfindung und ein menschliches Empfinden.” – wie wahr! Was ist schon Zeit?
Aber übrigens: So gut gehe ich mit Krisen nun auch nicht um. Diesen Blogpost habe ich quasi erst ein Jahr, nachdem diese Krise begonnen hat, zustande gebracht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich daran verzweifelt bin. Aber auch das gehört dazu. Ihr hier lest meistens erst etwas von mir, wenn ich es geschafft habe, mich so weit zu ordnen, dass ich es in Worte fassen kann. Ich bin also echt kein Profi, was das angeht.. aber auch das ist das Leben. Hoch und runter, immer wieder. Aber zu wissen, dass das Leben nunmal so ist – macht schon wieder einiges leichter! :)
<3
Schön sowas zu lesen
Ich gehe so gerne auf spielplätze und würde auch so gerne wieder auf hüpfburgen :D dafür wird man manchmal schräg angeguckt, aber meine Freunde verstehen das, weil sie gehen haben wie viel Spaß ich dabei habe
Andererseits erwische ich mich auch so oft bei zukunftssorgen und zweifeln
Ich glaube man muss da ein gesundes mittelmaß finden
Schließlich tragen wir Verantwortung für uns selbst und müssen deshalb eben manchmal Dinge beachten
Aber am Ende ist das wichtigste dass man jeden Moment lebt, ob es gerade ein Hoch oder tief ist. Wir haben nur das hier und jetzt und unseren erfahrungsschatz. Das morgen ist unsicher, deshalb sollte man den Moment genießen
Schön von dir zu lesen & so inspirierend :)
Wie schön, dass du das kannst! Manchmal muss man einfach ausrasten. Vor allem positiv. :)
Ach Angela <3 ich hoffe du findest deinen Weg! Nein ich weiß es! Denn jeder findet ihn früher oder später, wann ist egal, alles was dazwischen ist und dazu beiträgt ist gut und soll so sein! Ich dachte, nach deinem Hawaii Reise bist du angekommen aber anscheinend war es nur der Anfang :) ich freue mich aber dass wir Leser dich auf deiner Reise begleiten dürfen und wünsche dir alles Gute <3 Kinder sind wirkich ein tolles Beispiel, ich merke es selbst bei meiner kleinen Großcousine, dachte früher nämlich auch, ich kann nicht mit Kindern aber mit ihr ist alles anders! Es macht einfach Spaß mit ihr zu spielen, Kreide zu malen oder einfach nur zusammmen zu sein, sie zu beobachten. Wir können so viel lernen von Kindern! :)
Liebste Grüße und fühl dich gedrückt <3
Liebe Jasmin,
ach, was ist schon ankommen? Ich glaube, niemand kommt irgendwann wirklich an. Denn was würde das bedeuten? Dass man alles weiß, alles schon erlebt hat? Wie oft ich mir in meinem Leben einer Sache schon absolut sicher war – und ein Jahr später sah die Welt komplett anders aus. Ich bin immernoch auf dem Weg, auf dem Weg zu mir selbst. Manchmal bin ich näher dran, manchmal wieder weiter weg. Und ich glaube ehrlich gesagt, so wird es immer sein. Hoch und Runter. Aber genau das ist doch das Schöne am Leben. :)
Danke!! <3
Vielen Dank für deine letzten Texte, durch die ich selber über mein Leben und vor allem WIE ich Leben möchte, nachdenke.
Ich freue mich, dass Du uns an deinem Weg teilhaben lässt.
Danke dafür <3
Eigentlich ist es mir egal was andere über mich denken. Eigentlich. Also doch nicht ganz. Und das kleine, unscheinbare Eigentlich setzt mich ganz schön unter Druck. Falsch. Ich setzte mich selber unter Druck. Habe viel zu hohe Erwarten von mir selber. Denke viel zu oft, machst du morgen oder bald. Oder eben nie. Denke viel zu viel über die Zukunft und die Vergangenheit nach und verpasse das hier uns jetzt. Verpasse die Gegenwart.
Das ist ein guter Text. Ein verdammt guter. Ich mag es älter zu sein. Aber ich mag es auch Kind sein. Aber das Kind, das versteckt sich immer mehr je mehr Verantwortung auf einen zu kommt. Dann wird es dem Kind zu viel, zu stressig. Es wird eingeschüchtert. Und dann fangen wir an es zu beschützten und irgendwann kaum noch raus zu lassen. Aber genau das dürfen wir nie verlernen und wenn es doch passiert, wieder lernen. Kind sein, das ist manchmal die bessere Idee.
Liebe Melanie,
wenn du etwas “nie machst”, dann soll es wohl so sein. Dann ist es vielleicht einfach nicht dein Ding – oder das Leben zwingt dich dazu, dir einfach noch mehr Zeit damit zu lassen, weil jetzt nicht der richtige Augen blick dafür ist (außer natürlich es geht hier um die Steuererklärung oder so. ;))
Und sei nicht zu hart zu dir selbst! Jeder verpasst mal die Gegenwart, weil er sich zu viele Gedanken macht. Schau mich an! Aber vielleicht brauchen wir genau das, um wieder in der Gegenwart anzukommen. “Manchmal merkt man erst, was man aneinander hat, wenn man sich verliert” – das könnte man auch auf das Hier & Jetzt beziehen. Manchmal merkt man erst, dass man die Gegenwart aus den Augen verloren hat, wenn man sich mal wieder zu viele Sorgen um die Zukunft gemacht hat. Und dann ist man wieder da. Und dann hatte das Ganze auch wieder etwas Gutes. :)
<3
Was für ein wunderschöner Beitrag! Mir geht es seit ungefähr einem Jahr so, dass auch ich plötzlich mehr diesen Draht zu Kindern habe (ich bin jetzt 30). Aber du hast es auch so wunderschön beschrieben, es ist einfach eine Entwicklung und die fühlt sich auch absolut richtig an!
Ach Angela… ich finde dich einfach mit jedem deiner Texte noch ein bisschen toller. <3
Liebe Angela,
ich habe mich so gefreut, dass du doch wieder ein Blogpost veröffentlicht hast. Ich mag deine Texte so gerne. Dieser hier ist wunderschön. Beim Lesen hatte ich das Gefühl, als erlebe ich das selbst, was du schreibst.
Ich selbst möchte immer das innere Kind in mir bewahren, habe aber ein wenig Angst “sehr erwachsen zu werden”. Kinder sehen die Welt mit ganz anderen Augen und wir können von Kindern viel lernen. Aber wichtig ist, dass man selbst nicht vergisst, was man als Kind angestrebt hat.
Ganz viele Grüße
Natalie
https://www.livolett.de
Liebe Natalie,
ich muss dir (fast) das gleiche antworten, was ich oben zu Masha sagte. Ich glaube, unsere Generation ist ganz anders “Erwachsen” als die Genereation unserer Eltern. Ist ja auch logisch, da liegen teilweise 30 Jahre dazwischen. Was man damals im Erwachsenenalter anstrebte hat heute viel weniger Wert. Unser “Erwachsen” hat vielleicht einfach ein Stück wit weniger mit “Vernunft” zutun als damals..
Liebe Grüße und danke für den schönen Kommentar! <3
Eine Freundin von mir kam vor ein paar Tagen aus einem DNX Camp in Ägypten zurück. Ihre Arme waren voller blauer Flecken, die Beine voller Schrammen und sie erzählte mir alle dazuhörigen Geschichten – in diesem Moment hatte ich das selbe Gefühl. Einfach noch mal Kind sein, auf Bäume klettern und von der Schaukel fallen, aus dem Garten kommen und Grasflecken übersät sein, mit Opa einen Kastanienbaum pflanzen und einen rot verschmierten Mund vom Erdbeeressen haben..
Und so ganz nebenbei… ICH MAG, DASS DAS DER NÄCHSTE TEIL ÜBER KVOTHE ENDLICH RAUSKOMMT. *räusper* Okay. Wirklich jetzt. Ich habe mich damals so in diese Geschichte verliebt und ich bin einfach superduper gespannt, wie das alles weitergeht!
vielviel Liebe aus Hamburg ♥