Ich kann jetzt gerade keine Musik hören. Ich stehe an meinem Fenster, alles ist Grün, es hat wohl um die dreißig Grad. Ich wurde geweckt von Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht, und eigentlich sollte alles wunderbar sein, weil die Welt heute so wunderbar aussieht. Weil der Sommer endlich da ist und die Hitze eigentlich alle bösen Geister vertreiben sollte. Ich stehe an meinem Fenster und ärgere mich über die Sonne. Wie sie denn jetzt scheinen kann, wenn ich mich doch so mies fühle, und ich muss an einen Songtext von Farin Urlaub denken: “Traurig sein macht keinen Sinn, die Sonne scheint auch weiterhin.” Kann sich das Wetter bitte meinem Gemüt anpassen?
Mein Kopf ist so voll. Mir wird gerade alles zu viel. Ich beschäftige mich mit Problemen anderer, mit meinen eigenen, ständig klingelt das Handy und spätestens nach ein paar Stunden schreibe ich wieder nur Entschuldigungen in die 7 offenen Whatsapp-Chats, warum ich gerade nicht antworten kann, warum ich so wenig Zeit habe. Ich kann nichtmal Musik hören. Ich habe das Gefühl alles überfordert mich, meine Motivation ist am Boden. Am liebsten würde ich mich einschließen, die Sonne verbannen, mein Handy ausschalten… oder einfach abhauen. Irgendwo hin, wo es ruhig ist. In die Berge vielleicht, eine Hütte für mich allein. Ich will keine Musik, ich will keine Menschen. Ich will endlich mal wieder nur mich und meine Gedanken. Hatte ich das jemals?
Ich drehe mich um, mein Blick schweift durch mein Zimmer. Es ist perfekt aufgeräumt, fast klinisch rein sieht es aus. Ich habe mir letztens erst weiße Bettwäsche gekauft, damit es heller wirkt. Und ein paar weiße Aktenordner. Nichts liegt mehr rum, alles ist verstaut in Kisten, geordnet und aufgeräumt. Mittlerweile ist das einzige dunkle Möbelstück der verdammte Schreibtisch, an dem ich nichtmal arbeiten kann, weil er viel zu niedrig ist. Mein Kalender, ein paar ungeöffnete Briefe und ein Stift liegen darauf, akkurat in einer Reihe. Ich habe in letzter Zeit Stück für Stück versucht mein 13m2 Zimmer noch größer erscheinen zu lassen, weil ich manchmal das Gefühl habe ich könnte hier drin nicht mehr atmen. Ich könnte niemals arbeiten, wenn sich auch nur ein einziges Teil nicht an seinem Platz befindet. Am Boden vor meiner Kommode liegt ein Paket, und das quietsch-Orange der Verpackung stört schon jetzt wieder meine Optik. Aber wo soll ich es hin tun, meine Wohnung ist zu klein für alles. Letzte Woche erst habe ich wieder diesen weißen Sprühlack gekauft, die Heizkörper neu lackiert, sogar mein Wäschekorb ist nun weiß. Alles muss weiß sein, damit es mich nicht erdrückt, und obwohl ich so pinibel darauf achte, fühlt sich mein Zimmer gerade wieder an wie eine modrige, alte Kammer. Wie eine dunkle, braune Kiste, in der ich tagsüber gefangen bin. Jedes mal, wenn ich versuche kreativ zu sein, fühlt es sich an als würden meine Gedanken nicht fliegen können, weil sie schon nach zwei Metern an irgendwelchen Wänden abprallen. Ich muss hier weg.
Ich fülle meine Flasche mit Wasser auf, packe schnell meinen Rucksack, zieh’ mir irgendwas über und setze ich in das Auto meiner Eltern, welches gerade mein mir rumsteht. Gott sei Dank. Binnen zehn Minuten lasse ich die ätzende Stadt hinter mir und fahre auf der Autobahn Richtung Süden, ohne Ziel. Das Radio ist aus. Ich kann gerade keine Musik hören. Ich fahre an meinem Heimatdorf vorbei, überlege kurz, ob ich hier schon rausmöchte, entscheide mich aber dagegen und fahre noch ein paar Kilometer weiter, bis ich eine Ausfahrt finde, die mir gefällt. Und ich fahre ewig. Ich fahre durch ein Dorf, und es ist mir zu viel Stadt. Ich suche mir kleine Abzweigungen, die ins Nichts führen, möglichst weit raus auf die grünen, gelben, manchmal sogar bunten Felder und mit jedem Meter habe ich das Gefühl meinen Gedanken wachsen wieder Flügel. Die befestigte Straße, auf der ich mich befinde wird zu einem Schotterweg und ich übersehe das “Anlieger Frei” Schild. Jawohl, ich habe ein Anliegen. Als ich am Ende zwischen Nichts einen Hof entdecke seufze ich zum ersten mal auf. Es ist zwar kein kleiner, abgeschnittener Bauernhof, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich entscheide mich, dass meine Reise hier zu Ende sein soll. Ich parke auf dem Parkplatz vor dem schönen, alten Bauernhaus. Ab dem ersten Stock ist es mit dunklem Holz verkleidet, die Fensterläden sind dunkelgrün und ringsherum hängen unzählige Blumenkästen. Die Markise vor der Eingangstür überdeckt eine Holzbank auf der eine alte Dame sitzt, die mich beim Aussteigen verwundert mustert. Sie kennt wohl die Leute, die hier ein und aus gehen, und ich gehöre nicht dazu. “Grüß Gott”, sage ich, und sie schenkt mir ein Lächeln, dass mir sagt, “es ist in Ordnung, dass du hier bist”.
Es ist ein Pferdehof. Ich war nie ein Pferdemädchen, aber Pferde faszinieren mich. Ich laufe an den Ställen vorbei ohne einen zu betreten – ich glaube nicht, dass ich das darf, also umkreise ich einen der Ställe bis ich die Seite finde, an denen die Ställe nach Außen offen sind. Mein Blick fällt auf ein weißes Pferd mit dunklen Flecken, und ich muss unweigerlich lächeln, als ich mich nähere. Ich habe einen heidenrespekt vor diesen majestätischen Tieren und weiß nicht genau, wie ich mich verhalten soll, ohne es zu verschrecken. Ich stelle mich an die brusthohe Stalltür und sage so etwas wie “Hey”, ganz vorsichtig und ruhig. Es blickt mich desinteressiert an und erst als ich die Hand langsam nach vorne strecke bewegt es sich vom inneren des Stalls in meine Richtung. Ich habe keine Angst, aber mein Herz beginnt wie wild zu klopfen, als es durch die Nüstern warme Luft auf meine Hand bläst. “Oh, bist du aber schön”, sage ich, und streichle vorsichtig mit meinem Handrücken über die weiche, warme Schnauze. Die Ohren sind aufmerksam nach vorne gerichtet und ich glaube mich zu erinnern, dass das ein gutes Zeichen ist, also lege ich meine Handfläche auf seine Stirn, zwischen die Augen. Wieder ein schnaufen, noch ein Schritt mehr auf mich zu. Meine anfängliche Schüchternheit ist wie weggeblasen, ich grinse über das ganze Gesicht und erzähle dem Pferd irgend einen Blödsinn, wie schön es aussieht, wie tolle ich seine geflochtene Mähne finde und entschuldige mich dafür, dass ich ihm leider nichts zu Essen geben darf. Ein paar Sekunden später vertraue ich diesem Tier bereits mehr als mir selbst, klopfe ihm auf die Flanken, und als es versucht sich den Kopf an der Stalltür zu kratzen übernehme ich diese Aufgabe nur liebendgern. Ich sehe es an, nehme den riesigen Kopf in meine Hände und lege meinen Stirn zwischen seine Augen, es schnaubt ruhig und lässt mich einfach machen. Ich stehe da, den Geruch von Stall und Land in der Nase, das weiche Fell in meinen Händen und vergesse endlich. Meine Gedanken haben nicht nur Flügel bekommen, sondern tanzen gerade irgendwo Walzer am wolkenlosen Himmel.
Ich liege noch bestimmt eine ganze Stunde irgendwo im Gras neben einer Koppel, bevor ich mich wieder aufraffe. Ich habe heute noch einiges zutun und muss dringend wieder Heim. Auf dem Weg zurück besuche ich noch einmal Pferd, bedanken mich für die schönen Flausch-Minuten und hoffe inständig, dass sein Besitzer ein lieber, aufopferungsvoller Pferdeliebhaber ist. Wenn du wüsstest, wie sehr du mir gerade geholfen hast, Pferd.
Auf dem Weg nach Hause lasse ich die Fenster offen und spiele mein Lieblingslied auf Repeat. Ich kann jetzt wieder Musik hören. Zuhause angekommen schmeiße ich meinen Rucksack irgendwo in die Ecke, reiße alle Fenster auf und weiß endlich, worüber ich meinen Sonntagspost schreibe.
Sherry liegt auf meinem Bett und gibt ein gurrendes Geräusch von sich. Tiere, ey. Es gibt keinen besseren Balsam für die Seele.
<3
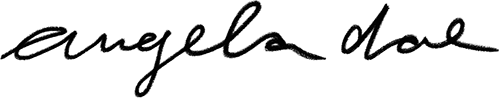









Sehr schöner Post.
Wie recht du hast. Tiere sind die besten Psychologen/Seelentröster überhaupt.
Der Wahnsinn wie viel einen so ein Tier geben kann.. in dem es einfach nur da steht und uns Unmengen an Liebe schenkt.
Das können sie sogar manchmal besser als jeder Mensch. Auch wenn man vollkommen allein sein will.. das gilt nicht für Tiere.
Sie sagen nix. Geben keine blöden Ratschläge die einem meist sowieso nicht helfen.
Du bist so toll und deine Schreibweise erst, deine Posts fesseln mich jedes Mal aufs Neue. DANKE
Ein wunderschöner Post. Als Pferdemädchen weiß ich genau wie du dich gefühlt haben musst, als die weiche Luft aus den Nüstern des Pferdes deine Hand traf. Mir gibt es immer ein Gefühl der Ruhe und des Friedens. Ich finde es toll, dass du aus den Mauern der Stadt ausbrichst, um dich selbst ein Stück aus dem Alltag heraus zu holen. Traurig sein oder eine schlechte Laune zu haben das gehört zum Leben dazu, aber die Fähigkeit sich selbst wieder ein stückweit glücklich zu machen das hat nicht jeder.
Da hast du recht. Pferde können so heilen einfach durch ihr sein und die wärme…
Saugut geschrieben! <3 Ich glaub, ich such mir jetzt auch n Pferd…
Ich hatte mal ein Kaninchen dass mich über 12 Jahre meines Lebens begleitet hat. wenn ich schlechte Laune habe denk ich immer wieder daran dass jetzt sicher alles wenigstens ein bisschen besser wäre wenn wenigstens die kleine Zunge meine Hand abschlecken würde aber leider ist der kleine irgendwann gestorben.. Ich vermiss meinen Seelentröster aber bin mehr als Dankbar ihn so lange gehabt zu haben und weiß dass das keine Selbstverständlichkeit war. Tiere sind einfach wunderbar :)
Oh wieder mal so schön geschrieben und jaaa Tiere habens einfach drauf! :D <3 ich liebe Pferde!
<3
ich sag das immer, aber deine Sonntagsposts sind die besten. Ich liebe deine Art zu schreiben so!
ich freu’ mich jede woche wieder auf deinen sonntagspost<3 du schreibst so, dass ich für ein paar minuten -egal wo ich gerade bin- in eine andere welt abtauchen kann und das ist gar nicht so einfach in der zeit, in der wir leben ;)
Ich habe jetzt wirklich Tränen in den Augen, weil ich durch den Umzug mein ehemaliges Pflegepferd so vermisse & du so gut das beschrieben hast, was ein Pferde-Besuch mit einem macht. Es geht einem besser.
Liebe Grüße :)
Es ist Montagabend und ich lese deinen Post, nachdem ich mich gestern Nachmittag mal wieder für die nächsten 4 Wochen von meinem Pony verabschieden musste. Sie konnte einfach nicht mitkommen in meine Studienstadt, genießt jetzt ihren Ruhestand und meine Mutter kümmer sich hervorragend um sie. Trotzdem kullert mir gerade eine Träne über die Wange.
Du hast das Gefühl welches Pferde einem geben einfach perfekt beschrieben. Im Stall ist die Welt immer in Ordnung <3
Ich dachte immer du wärst total der pro-soziale Mensch. Ich kann mich da an einen Sonntagspost von dir erinnern in dem du geschrieben hast, dass du gar nicht gut alleine sein kannst und immer Menschen um dich brauchst.
Da ich eher zum anderen Trend tendiere kann ich deinen Ausbruch im Alleingang total nachvollziehen. Bevor alles zu viel wird muss man einfach raus aus allem.
Welch ein schöner Post.. kann diesmal garnichts sagen außer toll, toll, toll !! <3
Wunder Wunder schöner text ❤️
[…] wichtig geworden. Erst vor ein paar Tagen bin ich aus heiterem Himmel alleine für ein paar Stunden auf’s Land gefahren, habe meine Seele einbalsamiert und bin wieder sortiert und geordnet Zuhause angekommen. Ruhe und […]